| Foto: Ausserhofer
"Ich ziehe den Schluss, dass es so etwas wie eine Sprache gar nicht gibt?"
Vom Sprechen und der Sprache
Prof. Dr. Sybille Krämer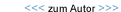
„Gibt es eine Sprache hinter dem Sprechen?“ fragt die Philosophin Prof. Dr. Sybille Krämer und erhält von bekannten Philosophen unterschiedliche Aussagen: So antwortet Donald Davidson uns kurz entschlossen mit „nein“. Ludwig Wittgenstein dagegen wird antworten: „Es gibt keine Sprache hinter dem Sprechen, aber es gibt Sprachspiele über Sprache neben Sprachspielen, in denen wir blind bleiben können für Regeln und Medium der Sprache“. Und Jacques Derrida wird schließlich antworten. „Ja, es gibt etwas hinter dem Sprachgebrauch als Bedingung seiner Möglichkeit (und Unmöglichkeit), aber das ist nicht die Sprache vielmehr ist das die Schrift“. In ihrem Essay geht Sybille Krämer dieser Frage nach und kommt zu einer überraschenden Antwort: Wenn die Sprache erst zur Schrift werden muss, um als identifizierbares und re-identifizierbares Schema, das im Sprechen jeweils angewendet wird, hervortreten zu können, dann verdankt dieses Schema seine Existenz den – immer auch historisch
zufälligen – Praktiken des Schriftgebrauches.
Ist etwas selbstverständlicher, als dass wir Wesen sind, die eine Sprache haben? Aber „haben“ wir tatsächlich eine Sprache? Und wenn ja, in welcher Weise? Gehört Sprache zu uns wie ein biologisches Organ oder eher wie ein benutzbares Werkzeug? Oder haben wir an der Sprache teil, wie wir an einer sozialen Institution partizipieren, etwa dem Geld?
Unser Leben ist eingelassen in eine Fülle von Praktiken, an denen auf ganz verschiedene Weise Vollzüge des Sprechens, Schreibens, Lesens und Verstehens beteiligt sind. Diese Verschiedenartigkeit wird ergänzt durch die Flüchtigkeit im Mündlichen: Kaum ausgesprochen, sind Worte auch schon verklungen. Wir können mündlich etwas wiederholen, es uns wieder zu holen gelingt nicht. Die Sprache hält im Strom des Sprechens nicht still.
Die substantivierende Rede von „der Sprache“ versorgt uns einerseits mit einem Quasi-Objekt. Doch andererseits begegnet uns Sprache nur in einer unüberschaubaren Vielzahl divergierender, amorpher und oftmals flüchtiger Prozesse.
Für das Nachdenken über die Sprache schafft das ein Problem: Wie gelingt es der Sprachwissenschaft, sich als eine eigenständige Disziplin zu etablieren, die über einen originären, einheitlichen und vor allem abgrenzbaren Gegenstand verfügt?
Es war die Erfindungsgabe von Ferdinand de Saussure, dem Begründer der modernen Linguistik, dafür eine wegweisende Lösung gefunden zu haben. Sprache ist ein Zeichensystem – doch dieses Zeichensystem beruht nicht mehr auf Repräsentation. Und das heißt: Sprache bezeichnet nicht länger eine ihr vorgegebene außersprachliche Ordnung, sei das nun die äußere Welt oder die Vernunft, sondern Sprache wird selbst zur Quelle von Ordnung und zur struktursetzenden Instanz. Sprache ist nicht repräsentierende Darstellung, vielmehr Artikulation. Artikuliert aber werden Unterscheidungen, die nur im Medium der Sprache zu treffen sind. Auf diese Weise macht Saussure die Sprache zu einem unabhängigen, selbstständigen Objekt. Der Preis für diese Autonomie ist allerdings eine Abwertung des Sprechens selbst. Im Verhältnis von „langue“ und „parole“ gilt das Sprechen für Saussure als Realisierung (coté exécutif) des Sprachsystems. Sprache und Sprechen verhalten sich dann zueinander wie eine Symphonie und ihre Aufführung. Das Sprechen zu erklären heißt dann, die Regeln der Sprache als System zu beschreiben.
Die Abwertung der Sprache
Der Linguist Noam Chomsky hat diese Idee aufgenommen und in einer Weise fortgebildet, die der Sprachwissenschaft zugleich einen Anschluss an die Kognitionswissenschaft eröffnet: Was Sprache ist, kann – in der Perspektive von Chomsky – auf dreierlei Art beschrieben werden: (1) In der Perspektive einer Maschine ist Sprache ein formales System, welches als eine Tiefenstruktur die Äußerungen auf der Oberfläche des Kommunikationsgeschehens generiert. (2) Unter dem Aspekt der Kompetenz ist Sprache ein implizites Wissensystem, über das verfügen muss, wer spricht. (3) Unter dem Blickwinkel der Kognitionsbiologie ist Sprache ein hirnphysiologisch instantiiertes Modul, mit dem die biologische Spezies Mensch ausgestattet ist. Doch egal, ob die Sprache nun als formales System, als Sprecherkompetenz oder als Hirnmodul beschrieben wird: Klar ist jedenfalls, dass diese Sprache Chomskys mit unserer intuitiven Vorstellung darüber, was eine Sprache ist, kaum mehr etwas gemein hat. Das alltägliche Sprechen selbst wird zum mängelbehafteten Abkömmling der universalen Sprache, da es geprägt ist von den einschränkenden Bedingungen psychischer und sozialer Faktoren, die den Sprachgebrauch beeinflussen. Das, wovon die Sprachwissenschaft handelt, ist dann nicht mehr das, was sich im alltäglichen Sprechen zeigt. Die Sprache als linguistischer Gegenstand zählt dann nicht (mehr) zu den wahrnehmbaren Phänomenen.
Diese radikale Trennung zwischen unserer lebensweltlich erfahrbaren Sprachlichkeit und der Sprache als linguistischem Gegenstand ist ein bemerkenswertes Phänomen: Was die Sprachwissenschaft unter „Sprache“ versteht, weicht ab von unseren gewöhnlichen Vorstellungen über Sprache.
So wundert es nicht, dass der zeitgenössische angelsächsische Philosoph Donald Davidson so weit geht, den Realitätsstatus dieser Art von Sprache radikal in Frage zu stellen: „Ich ziehe den Schluss, dass es so etwas wie eine Sprache gar nicht gibt, sofern eine Sprache der Vorstellung entspricht, die sich viele Philosophen und Linguisten von ihr gemacht haben.“ Wie lässt sich diese kontraintuitive Position plausibel machen? Das, was für Davidson in sprachtheoretischer Hinsicht signifikant ist, ist nicht, dass wir sprechen, sondern dass wir verstehen können. Davidson versteht sich selbst als ein Hermeneut der alltäglichen Rede. Für diese Fähigkeit, Äußerungen zu interpretieren – und das ist die irritierende Pointe von Davidsons Sprachreflexionen – ist es nicht notwendig, eine gemeinsame Sprache zu teilen. Wir müssen in der Sprache nicht übereinstimmen, um einander verstehen zu können. Das Argument, mit dem er diese Idee stark macht, bezieht sich auf das methodologische Verhältnis von Schema und Gebrauch, von dem Davidson bezweifelt, dass es zur Erklärung unserer Sprachlichkeit überhaupt sinnvoll ist. Tatsächlich wird immer, wenn das Verhältnis von Sprache und Sprechen – wie bei Saussure und Chomsky – als ein logisch-genealogisches Abhängigkeitsverhältnis aufgefasst wird, zugleich Gebrauch gemacht von der Unterscheidung zwischen einem Schema (Muster, Regelsystem oder Typus) und seiner Anwendung (Realisierung, Aktualisierung oder Instantiierung).
Aber ist es tatsächlich notwendig, die Relation zwischen einem Schema und seinem Gebrauch als ein methodologisches Instrumentarium ganz und gar zu verabschieden? Oder wäre es nicht möglich, diese Unterscheidung aufzugreifen und ihr einen neuen, einen gewandelten Sinn abzugewinnen?
Ludwig Wittgenstein hat uns – hierin übrigens an Goethe anknüpfend – daran erinnert, dass es nichts hinter den Phänomenen gebe. Dass also eine Tätigkeit, bei der wir Regeln oder Muster aufstellen, beschreiben, deuten, kommentieren oder gar abändern, selbst ein Phänomen, mithin eine Form von Praxis ist. Bezogen auf die Sprache: Eingeübt in das Brauchtum und die Gewohnheiten unserer Kultur folgen wir im Sprechen blind den Sprachregeln. Da, wo die Regeln der Sprache zum Gegenstand der Erörterung werden, handelt es sich – gemessen an der alltäglichen Rede – um ein wissenschaftliches Sprachspiel, das vom gewöhnlichen Gang lebensweltlicher Kommunikation wohl zu unterscheiden ist. Es beruht darauf, gewisse Phänomene wie den grammatischen Beispielsatz als maßstabsetzend und paradigmatisch auszuzeichnen. Regeln sind für Wittgenstein diskursive, also auf das Sprechen über Regeln angewiesene Phänomene. Wenn wir also ein Sprachschema aufstellen, so ist das selbst eine Form von Sprachgebrauch. Dann aber verhalten sich Schema und Gebrauch nicht mehr wie Tiefe und Oberfläche, wie Wesentliches und Akzidentielles zueinander; sie sind nicht mehr auf zwei unterschiedlichen Ebenen lokalisierbar, sondern liegen nebeneinander. Warum ein bestimmtes Schema und nicht ein anderes, warum ein bestimmtes Modell von Grammatik und nicht ein anderes Modell ausgezeichnet werden – darauf wusste Wittgenstein keine Antwort außer seinem „so machen wir es eben“. An der Faktizität kultureller Praktiken kommt bei Wittgenstein alles Begründen zu einem Ende.
Der französische Philosoph Jacques Derrida hat sich damit nicht abgefunden und ist über Wittgenstein hinausgegangen, indem er die regelsetzenden und regelkommentierenden Sprachspiele als Schriftspiele auffasste. Angelpunkt seiner Überlegungen ist es, das traditionelle Verhältnis zwischen Sprache und Sprechen in Analogie zu setzen zum Verhältnis zwischen Sprache und Schrift. An letzterem kann Derrida nun zeigen, dass nahezu alle Prädikate, mit denen die Sekundarität der Schrift gewöhnlich begründet wird, gerade auch und erst recht auf die Sprache selbst zutreffen.
Die Möglichkeit, die Sprache – wie Saussure dies getan hat – als ein Zeichensystem zu begreifen, erweist sich als eine Extrapolation von Attributen, die der Schrift zukommen. Dass die Sprache als ein arbiträres Zeichensystem aufzufassen sei, tritt erst im Medium der Schrift zu Tage.
Wenn wir also fragen: „Gibt es eine Sprache hinter dem Sprechen?“, so antwortet Davidson uns kurz entschlossen mit „nein“. Wittgenstein dagegen wird antworten: „Es gibt keine Sprache hinter dem Sprechen, aber es gibt Sprachspiele über Sprache neben Sprachspielen, in denen wir blind bleiben können für Regeln und Medium der Sprache“. Und Derrida wird schließlich antworten: „Ja, es gibt etwas hinter dem Sprachgebrauch als Bedingung seiner Möglichkeit (und Unmöglichkeit), aber das ist nicht die Sprache, vielmehr ist das die Schrift“.
Greifen wir diese Überlegung von Derrida auf. Was heißt es, dass die Sprache als ein Zeichensystem zu konzipieren, in irgendeiner Weise angewiesen ist auf die Schrift?
Mündliche Sprache bedarf der Stimme: Kaum ausgesprochen, ist der Wortlaut auch schon verklungen. Die „Gegebenheitsweise“ der Rede ist also ihr Verschwinden. So war es eine geniale Idee der Griechen, dass sie die phönizische Schrift, welche nur Konsonanten notierte, um Buchstaben für den kaum wahrnehmbaren Atemhauch der Vokale ergänzten und damit unser Alphabet schufen, mit dem eine nahezu lückenlose Niederschrift der gesprochenen Sprache möglich wurde.
Was scheint da selbstverständlicher als die Auffassung, dass die phonetische Schrift mit Buchstaben fixierte mündliche Sprache ist? Dass die Schrift aufgeschriebene Sprache sei, ist eine Definition, die sich erstmals bei Aristoteles findet und sich bis in zeitgenössische schriftwissenschaftliche Handbücher fortgesetzt hat.
In dieser Perspektive besteht die Leistungskraft des griechischen Alphabets darin, einzelnen Lauten Buchstaben zuzuordnen, so dass es möglich wird, das Nacheinander der Laute in der Zeit in das Nebeneinander einer Buchstabenfolge im Raum zu überführen.
Das Problem an dieser Sicht ist nur: Die gesprochene Sprache begegnet uns gar nicht als Abfolge von Einzellauten. Zwar kennt auch der Fluss des Sprechens Pausen, doch die kommen mit den Zwischenräumen im Schriftbild, also mit der grammatischen Gliederung des Satzes, keineswegs überein. Das, was die Schrift sichtbar macht, ist nicht das Sprechen in der zeitlichen Abfolge von Einzellauten, vielmehr Sprache eine syntaktische beziehungsweise semantische Form. Auf die Sichtbarkeit dieser Form kommt es an. Es ist nahezu ein Gemeinplatz, dass unser Umgang mit Symbolen sich unterscheiden lasse in das, was der Domäne der Sprache und was der Domäne des Bildes zugehörig ist. Gemäß dieser Gabelung zwischen dem Diskursiven und dem Ikonischen gilt die Schrift als Sprache und nicht als Bild. Doch zehrt das Medium der Schrift nicht von einer fundamentalen visuell-ikonischen Dimension, für die es im Lautfluss des Sprechens kein Analogon und kein Vorbild gibt? Und besteht dann die intellektuelle Leistung des griechischen Alphabets nicht gerade darin, einen im Prinzip unsichtbaren kognitiven Sachverhalt vor Augen zu stellen? Dieser Sachverhalt ist der phänomenal nicht zugängliche, weil gar nicht hörbare Umstand, dass die Sprache etwas ist, das aus nicht weiter zerlegbaren Grundeinheiten, den Phonemen als bedeutungstragenden Lauten besteht, aus deren regelhafter Kombination die sprachlichen Äußerungen dann hervorgehen. „Grammatik“ leitet sich ab von „gramma“, griech.: „Buchstabe“, und es ist auch kein Zufall, dass „stoichea“ im Griechischen sowohl „Atom“ als auch „Buchstabe“ bedeutet. Erst durch die Schrift wird die Identifizierbarkeit und Reidentifizierbarkeit von Grundbausteinen der Sprache tatsächlich gewährleistet. Das Phonem als abstrakte, unteilbare, sinnlich nicht wahrnehmbare Grundeinheit im Sprechereignis, erweist sich in dieser Perspektive als ein Epiphänomen des Graphems. Die Schrift liefert damit eine Planskizze, eine Kartographie, durch welche die sinnliche Fülle klangvoller Sprachvollzüge in diskrete Zeichen ausbuchstabierbar wird. Indem die Schrift die Sprache als Form und Struktur vor Augen stellt, zerlegt sie das Kommunikationsgeschehen, das sich immer vollzieht im Zusammenspiel von mimischen, gestischen, sprachlichen und musikalischen Elementen in sprachliche und nichtsprachliche Komponenten. Die Schrift stellt Sprache nicht einfach dar, sondern analysiert sie. Sie ist ein Medium zur Purifikation von Kommunikation.
Zu dieser Purifikation gehört auch die Trennung von Sprache und Musik. Wir können vermuten, dass es eine Wirkung der Buchstabenschrift ist, wenn Aristoteles zwischen musikalischem Ton &Mac226;psophos‘ und sprachlichem Laut &Mac226;phoné‘ unterscheidet? Denn so löst er eine ursprüngliche Intimität von &Mac226;logos‘ und &Mac226;melos‘ in der altgriechischen &Mac226;musiké‘ auf, die sich als Einheit von Musik, Tanz und Sprache verstand und auf die noch Platon anspielt mit seiner Parallelisierung von Grammatik und Musik.
Schrift als Modellbildnerin der Sprache
Indem die phonetische Schrift mit dem Anspruch auftritt, Sprache – aber eben auch nur die Sprache – zu visualisieren, schafft sie überhaupt erst einen Gegenstand wie die „reine“ Sprache. Damit zeichnet sich ein „linguistisches Relativitätsprinzip“ ab: Es hängt von Art und Leistungsfähigkeit der jeweiligen Schrift ab, was als sprachtheoretisches Objekt phänomenal überhaupt in Erscheinung treten kann. Die Schrift – so können wir all dies zusammenfassen – wird zur Modellbildnerin der Sprache.
Hier stoßen wir auf ein bemerkenswertes Phänomen. Gewöhnlich wird die abendländische Wissenschaftsentwicklung als ein Prozess zunehmender Abstraktion und Entsinnlichung interpretiert. Diese Sicht hat zuletzt der Philosoph Edmund Husserl in seiner Krisis-Schrift noch einmal nachhaltig vertreten. Doch beruhen Kraft und Dynamik der Verwissenschaftlichung nicht eher darauf, das kognitiv Unsichtbare, zum Beispiel abstrakte Gegenstände oder theoretische Entitäten, dem Register der Anschauung zugänglich zu machen? So dass also die unsichtbaren „logoi“ gerade sichtbar gemacht werden, also das, was allein der Vernunft zugänglich ist, nun auch versinnlicht wird? Für die Mystik entzieht sich das bloß Denkbare der Darstellbarkeit. Doch für die Wissenschaft ist denkbar, was im Medium konsistent gebildeter Zeichensysteme vor Augen zu stellen ist. In der Dimension des europäischen Okularzentrismus, der mit der Privilegierung des Auges gegenüber dem Gehör einher geht, ist es die Aufgabe der Schriftbildlichkeit, die Sprache als theoretische Entität und abstrakte Form überhaupt erst gegenständlich werden zu lassen und damit auch erst analysierbar zu machen. Darin bestand die Erfindungskraft des griechischen Alphabets.
Kommen wir zum Ausgang unserer Überlegungen zurück: Wenn die Sprache erst zur Schrift werden muss, um als identifizierbares und re-identifizierbares Schema, das im Sprechen jeweils angewendet wird, hervortreten zu können, dann verdankt dieses Schema seine Existenz den – immer auch historisch zufälligen – Praktiken der Schriftgebrauches. Und das heißt zugleich: Die Schrift visualisiert nicht einfach eine Sprache, die unabhängig von ihr gegebenen ist, sondern die Schrift bringt im Akt der Visualisierung das, was sie dabei vor Augen stellt, zugleich mit hervor. So machen die Praktiken der schriftsprachlichen Darstellung aus einem sprachwissenschaftlichen Konstrukt eine Faktizität.
Glossar
– Quasi-Objekt: durch die sprachliche Form der Substantivierung wird etwas „nach Art eines Gegenstandes“ vorgestellt.
– instantiiertes Modul: ein physiologisch lokalisierbarer seperater Mechanismus zur Informationsverarbeitung
– kontraintuitive Position: eine Auffassung, die dem gesunden Menschenverstand zuwider läuft
– Sekundarität: Zweitrangigkeit
– Graphem: Schriftzeichen
– Phonem: bedeutungsunterscheidender Laut in einer Sprache
– Epiphänomen: Begleiterscheinung
– Okularzentrismus: Die einseitige Privilegierung des Augensinnes gegenüber den anderen Sinnen
Literaturverzeichnis
Aristoteles: De anima II, S. 6-8.
Chomsky, Noam (1988): Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use, New York.
Davidson, Donald (1984): On the Very Idea of a Conceptual Scheme, in: ders., Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford, S. 183-198 (dt.: Wahrheit und Interpretation, Frankfurt a.M. 1990).
Davidson, Donald (1990): A Nice Derangement of Epitaphs, in: E. LePore (ed.), Truth and Interpretation. Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, Oxford 1986, S. 433-446 (dt. in: Die Wahrheit der Interpretation, hg. v. E. Picard u. J. Schulte, Frankfurt a.M. 1990, S. 203-228).
Derrida, Jacques (1988): Signatur, Ereignis, Kontext, in: ders., Randgänge der Philosophie, Wien (Marges de la Philosophie, Paris 1972), S. 291-314.
Günther, H., O. Ludwig (Hrsg.) (1994): Schrift und Schriftlichkeit. Writing and Ist Use, Berlin, New York, Handbuch, Bd. I, S. VII.
Husserl, Edmund (1969): Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Hamburg.
Joseph, John, E. (1997): The End of Languages as We Know Them, Anglistik 8, 2, S. 31-46.
Krämer, Sybille (1999): Gibt es eine Sprache hinter dem Sprechen?, in: Sprache und Sprachen in den Wissenschaften. Geschichte und Gegenwart, Hg. v. H.E. Wiegand, Berlin, New York, S. 372-403.
Platon, Philebos 17b
Saussure, Ferdinand (1916): Cours de linguistique générale, publié par Ch. Bally et A. Sechehaye, Lausanne/Paris (dt. 1931)
Stetter, Christian (1997): Schrift und Sprache, Frankfurt am Main a.M., S. 117ff.
Wittgenstein, Ludwig (1984): Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, Frankfurt a.M. (Werkausgabe Bd. 7), § 889.
Wittgenstein, Ludwig (1984): Philosophische Untersuchungen, Frankfurt a.M. (Werkausgabe Bd. 1), § 219.
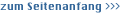
|